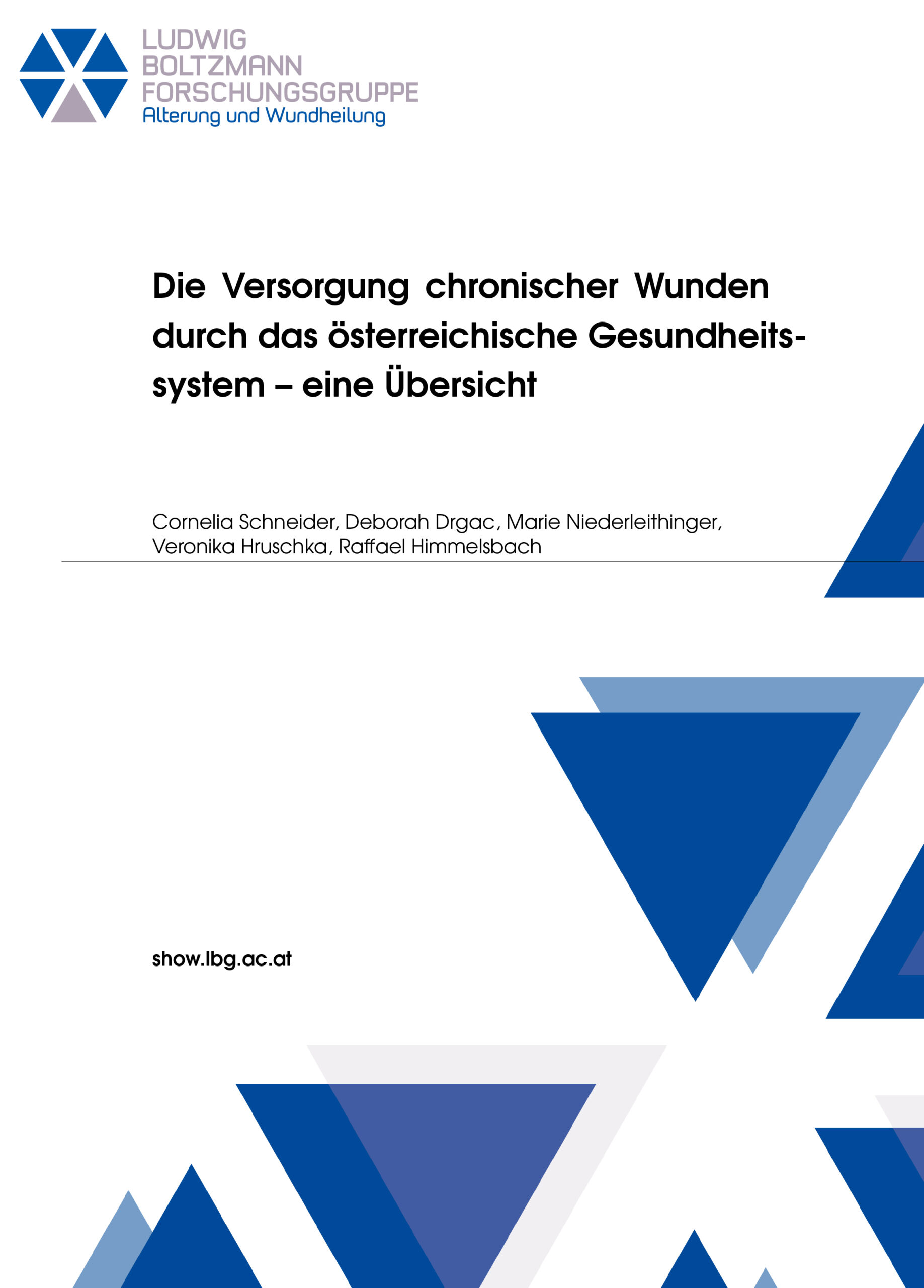Versorgungsforschung
Damit Patient*innen die Chance auf ein Leben ohne chronische Wunde haben, müssen verschiedene Gesundheitsberufe zusammenarbeiten. Die Betroffenen sind darauf angewiesen, dass Expert*innen die Ursachen ihrer beispielsweise offenen Beine erkennen und behandeln. Während chronische Wunden oft ältere Personen betreffen, erhöht die Zunahme an Gefäßerkrankungen und Diabetes auch bei jüngeren Menschen das Risiko. Die Ludwig Boltzmann Forschungsgruppe Alterung und Wundheilung hat mit Wund-Expert*innen gesprochen sowie verfügbare Dokumente ausgewertet − und kommt zu dem Schluss, dass es im österreichischen System aktuell an Koordination mangelt.
Eine chronische Wunde bedeutet für die betroffene Person oft Schmerzen, einen großen Einschnitt in die Bewegungsfreiheit und damit einhergehend eine psychische Belastung. Das kann sozial isolieren und Lohnarbeit verunmöglichen. Im täglichen Leben mit der Wunde sind auch die Angehörigen extrem gefordert. Es zeichnet sich ab, dass künftig wahrscheinlich mehr Österreicher*innen mit chronischen Wunden leben werden: Die Bevölkerung wird im Schnitt älter; zudem häufen sich Risikofaktoren in der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. Das Problem wurde in Österreich bisher nicht wissenschaftlich untersucht. Die Forscher*innen aus den Bio- und Politikwissenschaften sowie der öffentlichen Gesundheit schaffen mit ihrem “Wundbericht” einen Überblick. Diesen haben sie aus Gesprächen mit Expert*innen und der Analyse von gesundheitspolitischen Dokumenten und wissenschaftlicher Literatur angefertigt.
“Unsere Vorstellung von Wunden ist stark von Verletzungen, wie Schnitt- oder Schürfwunden geprägt. Waschen, Pflaster drauf, passt schon. Chronische Wunden sind anders. Sie werden mit der Zeit oft sogar größer”, sagt die Erstautorin Cornelia Schneider. Eine chronische Wunde muss mitunter mehrmals die Woche zeitaufwendig begutachtet, gesäubert und neu verbunden werden. Damit die Wunde verschwinden kann, braucht es aber vor allem eins: Kommunikation.
Pflegefachkräfte, Ärzt*innen für Allgemeinmedizin sowie Fachärzt*innen der Dermatologie, Gefäßchirurgie, Angiologie und Diabetologie müssen sich über institutionelle Grenzen hinweg absprechen, damit bei der betroffenen Person die Ursache, also ihre Primärerkrankung wie z.B. eine bestimmte Durchblutungsstörung , gefunden und behandelt wird. Die Kommunikation der Fachkräfte ermöglicht zudem, dass Patient*innen rasch die angemessenen Verbandsmaterialien erhalten können. Derzeit geschieht dies häufig nur, wenn sich Einzelpersonen engagieren. Eine österreichweit einheitliche Behandlungsqualität für alle Wund-Patient*innen kann so nicht gewährleistet werden. Aus unterschiedlichen “Einfahrten” wie der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK), venöser Insuffizienz oder Diabetes mellitus drehen die Patient*innen im Kreisverkehr der Wundbehandlung gemeinsam ihre Runden – mitunter über Monate ohne gestellte Diagnose. Ob und wie schnell Personen da wieder herauskommen können – und möglichst nicht mit einer weiteren Wunde wieder hineingelangen – liegt neben der Beteiligung der Betroffenen vor allem in der Verantwortung der System-Gestalter*innen.
In ihrer Analyse sind die Forscher*innen auch auf viele statistische Lücken gestoßen. Raffael Himmelsbach, Studienleiter und Co-Direktor der Forschungsgruppe, sagt: “Wenn ich von meiner Arbeit erzähle, dann höre ich regelmäßig: ‘meine Oma/mein Opa ist betroffen.’ Wir haben hier ein reales Problem. Doch statistisch ist es unsichtbar.” Das Ausmaß chronischer Wunden in Österreich und die Zusammensetzung nach unterschiedlichen Erkrankungsursachen kann nicht beobachtet werden, solange Diagnosen im hiesigen Gesundheitssystem nicht einheitlich erfasst werden. Ob es flächendeckend genügend Anlaufstellen für Betroffene gibt, bleibt unsicher.